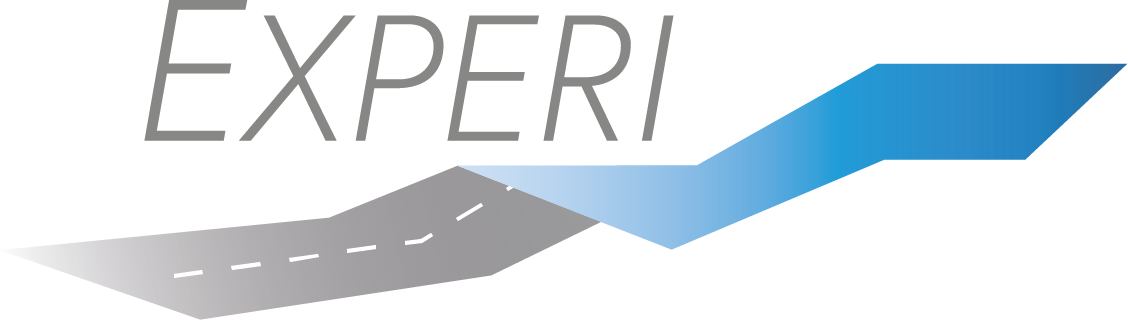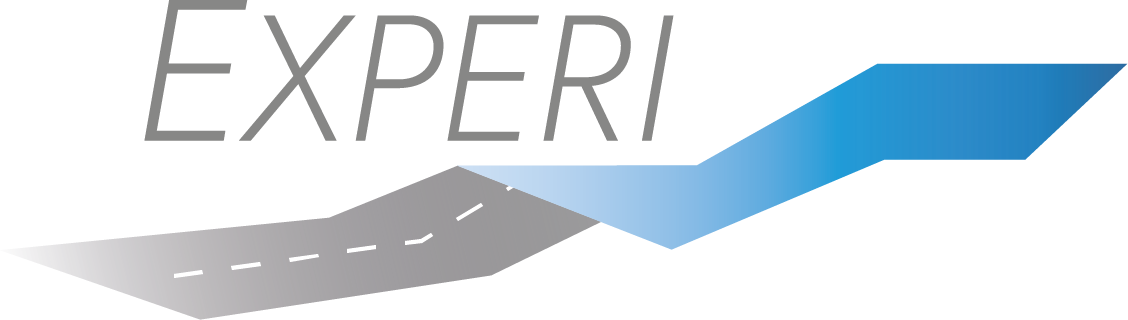Das Ziel dieses Teilprojekts ist es, die Berliner Verkehrswende als Transformationsprozess zu erforschen und zu einem grundlegenden wissenschaftlichen Verständnis der sozialen Dynamiken nachhaltiger Mobilität beizutragen. Darüber hinaus werden mithilfe inter- und transdisziplinärer Forschungsmethoden neue Gestaltungsmöglichkeiten für ein nachhaltigeres Verkehrssystem erarbeitet. Die Ergebnisse dieses Teilprojekts sollen die Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Berliner Transformationsprozess so aufbereiten, dass sie für die Gestaltung einer Verkehrswende in anderen Städten nutzbar sind.
Mehr Wohnungen durch die Verkehrswende? Wie sieht die Stadt nach der Verkehrswende aus? Wer mit offenen Augen durch unsere von der autogerechten Stadtplanung geprägten Städte läuft, erfasst schnell, dass Automobilinfrastruktur durch Tankstellen, Waschanlagen, Werkstätten, Autohäuser, Autoverleihe, Parkhäuser, Reifenhändler und Recyclinghöfe große städtische Flächen einnimmt. Alexander Czehs Arbeit erfasst diese und untersucht wie viele dieser Flächen nach der Verkehrswende noch benötigt werden und ob Flächen der Automobilinfrastruktur z. B. für Wohnungen, Klimaanpassungsmaßnahmen oder urbane Landwirtschaft genutzt werden könnten.
Im Zuge der Mobilitätswende und Klimaanpassung wird der Straßenraum neu verteilt. Parkstreifen und Fahrtstreifen werden zu geschützten Radwegen, entsiegelten und bepflanzten Flächen und Aufenthaltsräume. Das verläuft meist nicht ohne Widerstand und Konflikte. Katharina Götting untersucht daher, was die Akzeptanz von Flächenumverteilung und der Einrichtung von Superblocks beeinflusst. Dabei liegt der Fokus vor allem auf die wahrgenommene Fairness und verschiedenen Gerechtigkeitsframings.
Jedes Jahr sterben Menschen im Straßenverkehr. Das Forschungsvorhaben von Marlene Sattler widmet sich der Frage, wie der Diskurs über getötete Menschen im Straßenverkehr vor dem Hintergrund der Entstehung des Mobilitätsgesetzes in Berlin geführt wird. Es werden Diskurskoalitionen ausgemacht, im Kontext von diskursprägenden Ereignissen wie Mahnwachen für getötete Radfahrer:innen untersucht und mit Hilfe des Konzepts des institutional work analysiert.
Soziale Aspekte gewinnen in den aktuellen Diskursen über die Verkehrswende und geeignete Maßnahmen dieser immer mehr an Bedeutung. Der Fokus liegt dabei vor allem auf Fragen der Verteilung. In Anlehnung an das Konzept der Mobilitätsgerechtigkeit und der Just-Transition Literatur wird jedoch deutlich, dass soziale Aspekte in der Verkehrswende viel mehr sind. So geht es in einer sozial-gerechten Verkehrswende auch um eine gerechte Gestaltung der Verfahren. Anke Kläver untersucht daher, die verschiedenen Aspekte einer sozial-gerechten Verkehrswende. Dabei liegt der Fokus vor allem auf dem Zusammenspiel von Verteilungs- und Verfahrensbelangen.
Im Forschungsvorhaben wird experimentell untersucht, wie urbane Aufenthaltsqualitäten erhöht, öffentliche Räume für die Stadtbewohner*innen geschaffen und eine gesundheitsfördernde Fortbewegung ermöglicht werden kann. Im Rahmen eines Realexperiments wird eine Kreuzung in Berlin Charlottenburg für einen temporären Zeitraum in einen Stadtplatz umgewandelt. Zudem wird eine Umgestaltung zur Fußgängerzone in Berlin Kreuzberg im Rahmen eines transdisziplinären Prozesses begleitet und erforscht.